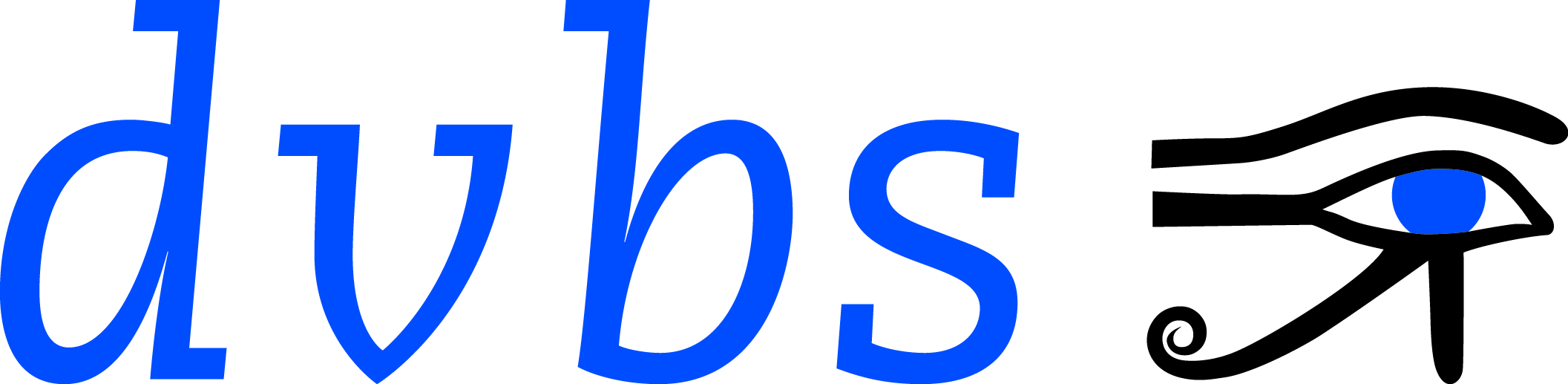Informationen für sehbehinderte Erwerbstätige
- Low-Vision-Beratung. Wenn das Sehen schlechter wird: Eine Low-Vision-Beratung (Sehrestberatung) ist immer eine sehr gute Wahl. In aller Regel können Low-Vision-Berater fundierter als Augenärzte über geeignete Hilfsmittel und sinnvolle Trainings besonders für Berufstätige, Auszubildende und Studierende informieren und entsprechende Tests anbieten. Sie stellen in aller Regel eine breite Palette an Hilfsmitteln zum Ausprobieren zur Verfügung.: http://low-vision-kreis.de/ und dbsv.org/sehhilfen-low-vision.html. Low-Vision-Beratung: Wer finanziert? Für Berufstätige gilt: Die Kosten werden auf Antrag entweder vom zuständigen Integrationsamt (www.integrationsaemter.de), der zuständigen Arbeitsagentur (www.arbeitsagentur.de/privatpersonen), der zuständigen Rentenversicherung (www.deutsche-rentenversicherung.de) oder auch der je nach Branche zuständigen Berufsgenossenschaft finanziert. Ein vorliegendes augenärztliches Gutachten ist zumeist die nötige Voraussetzung. In Einzelfällen übernehmen auch Krankenkassen die Kosten. Am besten: Einfach anrufen bei der Low-Vision-Beratung (Sehrestberatung) der Wahl und sich dort genau erkundigen.
- Peer to Peer –Beratung. Beratung auf gleicher Augenhöhe durch selbst von Sehbehinderung betroffene Menschen, die einfach nur Gesprächspartner sind, die verstehen, die ihre Erfahrungen weitergeben und mit Tipps und Hinweisen helfen, ehrenamtlich. Kontakte unter dvbs-online.de,die Selbsthilfeorganisation blinder und sehbehinderter Menschen in Beruf und Bildung.
- Rat und Hilfe bei Sehverlust. Eine kostenlose Beratung an vielen Beratungsstellen in der Republik bietet „Blickpunkt Auge“: blickpunkt-auge.de
- Berufsberatung für sehbehinderte und blinde Menschen in Ausbildung, Studium und Beruf: dvbs-online.de, die Selbsthilfeorganisation blinder und sehbehinderter Menschen in Beruf und Bildung. Auch die Arbeitsagenturen, Rentenversicherungen und Jobcenter bieten auf Anfrage entsprechende Beratungen an.
- Hilfsmittel für blinde und sehbehinderte Menschen. Einen breiten und informativen Überblick bietet: rehadat-hilfsmittel.de/de/infothek/blindenhilfsmittel/
- Hilfsmittelberatung ist auch Vertrauenssache. Alle Hilfsmittelhersteller und –vertreibende bieten Beratung an. Dass sie auch Verkaufsinteressen haben, versteht sich von selbst. Sehr erfahren in berufsbezogener, hersteller- und produktübergreifender Hilfsmittelberatung sind auch die Sozialunternehmen der Beruflichen Rehabilitation blinder und sehbehinderter Menschen: http://360grad-experten.de; http://www.nikosehzentrum.de; blista.de/res; www.lwl-bbw-soest.de; www.sfz-chemnitz.de
- Moderne Technologien für blinde und sehbehinderte Menschen: Digitale Medien und Geräte bieten viele Chancen für sehbehinderte und blinde Menschen. Sie haben aber auch ihre Tücken, und sie müssen ins technische Umfeld passen. Das Projekt incobs bietet einen guten Überblick und viele hilfreiche Informationen: http://www.incobs.de
- Hilfsmittelanbieter: Hilfsmittel müssen „passen“. Da gibt es keine generellen Lösungen. Sie müssen individuell ausgewählt und ausprobiert werden. Auch Hilfsmittelanbieter sind nicht gleich. Wählen Sie, erproben Sie: dbsv.org/hilfsmittel.html
- Trainings in Mobilität und lebenspraktischen Fähigkeiten für hochgradig sehbehinderte und von Erblindung bedrohte Menschen. Wenn die Augen ihren Dienst für die Bewältigung von Alltag und Beruf zu versagen drohen, sind neben den passenden Hilfsmitteln auch Trainings nötig, möglichst frühzeitig. Fachkundige Anbieter aus der ganzen Republik haben sich zusammengeschlossen und sind zu finden unter: rehalehrer.de
- Berufliche Weiterbildung. Sehbehinderung im Beruf, Änderung von Arbeitsaufgaben, Jobwechsel, kein Verzicht auf Karriere: Fast immer ist berufliche Weiterbildung nötig oder sinnvoll. Aber sie muss trotz / angesichts von Sehbehinderung zugänglich und nutzbar sein. Unter http://weiterbildung.dvbs-online.de finden Sie die deutschlandweit zentrale, barrierefrei zugängliche Weiterbildungsplattform mit barrierefrei nutzbaren Weiterbildungsangeboten.
- Fachkundige und sensible psychotherapeutische Beratung empfiehlt sich, wenn sich das Sehen stark verschlechtert oder sogar Blindheit droht: Die so bedingten seelischen Belastungen sind oft nur mit fachkundiger Unterstützung gut zu bewältigen. Eine kleine, unvollständige Liste selbst betroffener und/oder in der Zusammenarbeit mit sehbehinderten Menschen erfahrener Therapeuten soll weiterhelfen. Auch hier gilt: Wählen und erproben Sie: dbsv.org/psychologische-beratung.html
- Augenerkrankungen sind bei nicht selbst betroffenen Menschen kaum bekannt. Um sich die Erkrankungen besser vorstellen zu können, helfen Filme bei „einsehen“: http://www.woche-des-sehens.de/filme/die-simulationsfilme-der-woche-des-sehens/. Eine auch für Laien verständliche textliche Darstellungen der wichtigsten Augenkrankheiten findet sich unter: dbsv.org/augenkrankheiten.html
- Hauptkategorie: Fachgruppen
- Zugriffe: 10036
Videos der Woche des Sehens 2012: Augenkrankheiten
- Sehbehinderung im Alltag
- Diabetische Retinopathie
- Glaukom (Grüner Star)
- Katarakt (Grauer Star)
- Altersbedingte Makula-Degeneration
- Hauptkategorie: Fachgruppen
- Zugriffe: 3565
Interessengruppe „Sehbehinderte“
Was ist eine Sehbehinderung? Eine Antwort auf diese Frage würden Augenärzte an der Sehschärfe (Visus) und dem Grad der Gesichtsfeldeinschränkung festmachen. Für die Betroffenen selbst ist die subjektive Wahrnehmung jedoch viel bedeutsamer als eine objektiv messbare Größe. Verschiedenartige und unterschiedlich ausgeprägte Seheinschränkungen können beispielsweise bedeuten:
- sich in der Umwelt orientieren zu können, aber nur bedingt Gesichter erkennen und lesen zu können,
- blendempfindlich zu sein, aber im Schatten und bei Dunkelheit kaum etwas zu sehen,
- Zeitung lesen zu können, aber aufgrund einer Gesichtsfeldeinschränkung im Straßenverkehr auf einen weißen Stock oder Führhund angewiesen zu sein,
- abhängig von der Tagesform etwas / jemanden erkennen zu können oder nicht.
Einen Eindruck erhalten Sie durch die Demo-Filme der "Woche des Sehens".
Informationen für erwerbstätige sehbehinderte Menschen finden Sie hier.
Nicht sehend - nicht blind
So unterschiedlich die Probleme sehbehinderter Menschen sind, ist doch für das Empfinden eines gemeinsam: Man bewegt sich ständig irgendwo zwischen Sehen und Nichtsehen. Menschen mit einer Sehbehinderung stehen oft vor der Alternative, ihre Behinderung zu verstecken bzw. zu ignorieren, um nicht aufzufallen, oder sie offen zu zeigen mit allen Konsequenzen.
Schwierigkeiten, mit denen Menschen mit einer Sehbehinderung immer wieder konfrontiert werden, liegen im Bereich der Kommunikation: Nonverbale Kommunikation (Blickkontakt, Zunicken, Zuwinken, Mimik und Gestik) oder das wieder Erkennen von Personen ist nur bedingt, z.B. nur aus der Nähe oder bei bestimmten Lichtverhältnissen möglich. Wann die Bedingungen günstig sind, ist aber oft schlecht vorherzusagen, und so kann es auf beiden Seiten zu Verwirrung und Missverständnissen kommen, etwa dann, wenn man von anderen für uninteressiert oder arrogant gehalten wird.
Zudem können Seheinschränkungen einen progressiven Verlauf nehmen. Die Angst davor, das vorhandene Sehvermögen könne sich verschlechtern oder gar ganz verloren gehen, begleitet viele von einer Seheinschränkung Betroffene und stellt zusätzliche Belastungen dar. In unserer Interessengruppe kann man Menschen begegnen, die ihre Sehbehinderung mit viel Energie und Zuversicht gemeistert haben. Man kann offen über alle Widrigkeiten im Zusammenhang mit der Sehbehinderung sprechen. Am wichtigsten ist aber die Ermutigung durch unzählige Beispiele von Betroffenen das Leben mit Zuversicht und Freude anzugehen. Da sind wir wirklich ansteckend!
Der Interessengruppe Sehbehinderte gehören alle DVBS-Mitglieder an, die sich selbst als sehbehindert definieren und ihre spezifischen Bedürfnisse äußern bzw. vertreten wollen. Wir sind Menschen mit angeborener und auch erworbener Sehbehinderung. In der Fachgruppe treffen sich Mitglieder, die ihren Beruf mit Sehbehinderung erlernt haben, Mitglieder, die aufgrund der Sehbehinderung eine berufliche Neuorientierung durchliefen und Mitglieder, die ihre Berufstätigkeit ganz aufgeben mussten.
Die Schwerpunkte der Interessengruppenarbeit
Der Erfahrungsaustausch mit anderen Betroffenen ist das Hauptanliegen der Interessengruppe. Dazu gibt es verschiedene Angebote:
1. Seminare
Jedes Jahr wird ein Seminar „Nicht sehend – nicht blind“ mit verschiedenen Themen angeboten. In diesem Rahmen können die alltäglichen Situationen und teilweise auch Schwierigkeiten von Betroffenen gemeinsam dargestellt und alternative Lösungsmöglichkeiten gesucht werden. Die Seminarthemen beinhalten folgende Schwerpunkte:
a) Sehbehinderung und Beruf
Ergonomie bei der Arbeit hat eine besondere Bedeutung bei einer Sehbehinderung. Welche Tricks und Kniffe gibt es, um den beruflichen Alltag zu erleichtern? Welche Arten der Unterstützung gibt es? Unzählige Situationen könnten hierfür geschildert werden. Seminarthemen der Vergangenheit waren:
- Optisch vergrößernde Sehhilfen: Professionelle und individuelle Beratung zu Sehhilfen kombiniert mit einer Ausstellung spezieller Sehhilfen.
- Sehbehinderung und EDV: Schulung der gängigen Office-Anwendungen unter Berücksichtigung sehbehindertengerechten Techniken und Hilfsmittel.
- Arbeitsplatzassistenz: Die besondere Situation sehbehinderter Arbeitnehmer/innen mit Assistenz sowie ihr Assistenzbedarf.
- Präsentationstechniken: Darstellung der eigenen Person in beruflichen Zusammenhängen. Gestaltungsmöglichkeiten einer Vortragssituation.
- Selbstdarstellung im Beruf: Wirkung und eigene Darstellung im Arbeitsalltag. Rückmeldung und neue Umgehensweisen.
- Visuelles Gedächtnistraining: Sicherheit und Entspannung im beruflichen Handeln durch das Trainieren des visuellen Gedächtnisses.
- Stressbewältigung: Stressfaktoren, deren Bezug auf die Sehbehinderung sowie Lösungsmöglichkeiten erkennen.
b) Umgang mit der Sehbehinderung
Sehbehinderungen können Stress und Missverständnisse verursachen. Nicht nur im beruflichen Alltag können daher die Anwendung von Entspannungstechniken oder die Problem-Darstellung in Selbsterfahrungsgruppen dazu beitragen, den Stress abzubauen:
- Ganzheitliches Sehtraining: Ein Einblick in die Methode. Nutzungsmöglichkeiten für Sehbehinderte, vor allem, um die Augen zu entspannen.
- Kommunikation: Wo und wie kann ich mein Sehvermögen in der Kommunikation mit anderen einsetzen, wo entstehen Missverständnisse, wie kann ich mit diesen Missverständnissen umgehen?
- Verstecken oder offenbaren: Wo verstecke bzw. zeige ich meine Sehbehinderung in der Kommunikation mit anderen?
2. Treffen der Interessengruppe
Diese finden in der Regel am Rande der Mitgliederversammlungen des DVBS statt. In diesem Rahmen können aktuelle Themen besprochen werden und es gibt die Möglichkeit eines Erfahrungsaustauschs.
3. Zusammenarbeit mit dem Fachausschuss für die Belange Sehbehinderter (FBS)
Der FBS besteht aus Delegierten des DVBS, des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbandes (DBSV), des Bundes zur Förderung Sehbehinderter (BFS), der Pro Retina Deutschland, der Albinismus Selbsthilfegruppe (NOAH) und des Verbandes der Blinden- und SehbehindertenpädagogInnen (VBS). Dieses Gremium berät die Vereine und vertritt die Interessen Sehbehinderter in der Fachöffentlichkeit im Auftrag der Vereine (Fachverbände, Gremien, Ausschüsse).
Der FBS hat breit gestreut die vielfältigen Themen, die sehbehinderte Menschen betreffen, behandelt. Vor allem wurde in den Verbänden dafür geworben, mehr für sehbehinderte Menschen zu tun und Impulse für die Verbandsarbeit gegeben. Seine Mitglieder haben in Gremien (z.B. G-BA, DIN-Normung, Optikerverbände) klare Positionen für unsere Verbände bezogen.
Der FBS wird sich in Zukunft mehr der Low-Vision-Rehabilitation – das ist einfach gesagt, die gesamte Hilfe sich im Leben als sehbehinderter Mensch zurecht zu finden - und der Patientenvertretung in Entscheidungsgremien widmen. Im Rahmen der verstärkten Zusammenarbeit aller Fachausschüsse der Sehbehindertenselbsthilfe werden Mitglieder des FBS in Projekten für die Belange Sehbehinderter werben und ihre Erfahrungen einbringen.
4. Mailing-Liste
Die IG Sehbehinderte bietet ihren Mitgliedern eine Mailing-Liste an. Dieses E-Mail-Forum dient dem Austausch von Erfahrungen, Informationen und Meinungen zu der Fachgruppe und anderen sehbehindertenrelevanten Themen. Wer Interesse an diesem Forum hat und in die Liste eingetragen werden möchte, kann eine E-Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! mit der Bitte um Aufnahme schicken.
- Hauptkategorie: Fachgruppen
- Zugriffe: 5453